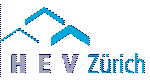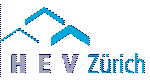| |
|
Bürgschaft
rz. Ein Vermieter und ein Mieter
schliessen einen Geschäftsmietvertrag ab. Da es sich beim Mieter um eine
im Aufbau befindliche Einzelfirma handelt, verlangt der Vermieter als
Sicherheit für die monatlichen Mietzinszahlungen eine Bürgschaft von
dessen Vater, der eine einflussreiche, finanzkräftige Persönlichkeit
ist. Dabei stellt sich die Frage, in welcher Form eine solche Bürgschaft
abzuschliessen ist. Schriftlichkeit - öffentliche Beurkundung - per
Handschlag?
Durch einen Bürgschaftsvertrag,
der zwischen Bürge und Gläubiger abgeschlossen wird, verpflichtet
sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger des Hauptschuldners,
für die Erfüllung der Schuld einzustehen. Bei der Bürgschaft
handelt es sich um ein sogenanntes akzessorisches Rechtsgeschäft, d. h.,
eine verbindliche Bürgschaft entsteht nur, wenn eine gültige
Hauptschuld, sprich im vorliegenden Fall ein gültiger Mietvertrag,
vorhanden ist. Die Bürgschaft ist nicht die einzige akzessorische
Verpflichtung im Gebiete des Privatrechts. Es gibt daneben noch andere
Vertragsarten, die zur Sicherung einer Schuld dienen: die Konventionalstrafe
und das Pfandrecht, wobei bei diesen der Schuldner meistens selbst die
zusätzliche Sicherung vornimmt, und nicht ein Dritter.
Schwierigkeiten bereiten oft die Abgrenzungen der Bürgschaft
gegenüber den Garantieverträgen (z. B. Bankgarantie) und dem
Schuldbeitritt. Gegenüber der Garantie liegt der Unterschied darin, dass
jede Bürgschaft akzessorisch ist, während der Garant beim
Garantievertrag sich selbständig, d.h. eben nicht akzessorisch,
verpflichtet; der Garant steht für die Leistung als solche ein, der
Bürge dagegen für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners. Dem
Garant stehen demnach keine Einreden aus dem Mietvertrag gegenüber dem
Gläubiger des Hauptschuldners zu. Beim Schuldbeitritt erklärt eine
Drittperson, dass sie neben dem Hauptschuldner für die monatlichen
Mietzinszahlungen aufkommen werde, sollten diese nicht bezahlt werden.
Gegenüber dem Garantievertrag behält der Solidarschuldner die
Einreden aus dem Mietvertrag, weshalb der Schuldbeitritt der Bürgschaft
sehr ähnlich ist. Massgebend für die Auslegung ist der von den
Parteien durch den Vertrag angestrebte wirtschaftliche Erfolg. Erhält der
hinzutretende Schuldner keine Gegenleistung und hat er kein eigenes,
ausgeprägt im Vordergrund stehendes Interesse an der Erfüllung der
Schuldpflicht, so wird im Zweifel Bürgschaft anzunehmen sein.
Im
Vergleich zum Garantievertrag und zum Schuldbeitritt ist der
Bürgschaftsvertrag in der schweizerischen Gesetzgebung (Art. 492 ff. OR)
sehr umfangreich geregelt worden, vorallem bezüglich der formellen
Voraussetzungen. Während die Bürgschaftserklärung einer
juristischen Person in schriftlicher Form möglich ist, bedarf sie bei
natürlichen Personen, sofern der Haftungsbetrag Fr. 2000.-
überschreitet, der öffentlichen Beurkundung, was mit Notariatskosten
verbunden ist. In allen Fällen muss zudem der Haftungsbetrag vom
Bürge zahlenmässig genau bestimmt und eigenhändig in der
Bürgschaftsurkunde aufgeführt werden. Dabei genügt die blosse
Bestimmbarkeit der Haftungssumme nicht, auch dann nicht, wenn die Bestimmung
des Haftungsbetrages unter Zuhilfenahme einer einfachen rechnerischen Operation
erfolgen kann, denn der Bürge muss den Höchstbetrag seiner Haftung
bei der Bürgschaftsübernahme vor Augen gehabt haben. Somit ist eine
Bürgschaft in der Form von «3 Monatszinsen» oder
«Fr. 3000.- plus Zins» grundsätzlich
ungültig, und der ganze Bürgschaftsvertrag fällt dahin. Beim
zweiten Beispiel wäre eine Ungültigkeit meines Erachtens zu
formalistisch und müsste eine Verbürgung wenigstens mit Bezug auf das
in der Verpflichtung zahlenmässig bestimmte Kapital von Fr.
3000.- oder schlechthin bis Fr. 3000.- (Kapital inkl.
gesetzlicher oder vertragsmässiger Zins) gültig sein.
Stellt
sich eine verheiratete Person als Bürge zur Verfügung, braucht es
dazu die schriftliche Zustimmung des Ehegatten, wenn die Ehe nicht durch
richterliches Urteil getrennt ist. Eine Ausnahme von der Zustimmung ist dann
gegeben, wenn der Bürge im Handelsregister eingetragen ist.
Bei
der Bürgschaft gibt es neben Nebenarten zwei Hauptarten, nämlich die
einfache Bürgschaft und die Solidarbürgschaft. Während bei der
einfachen Bürgschaft der Bürge grundsätzlich erst belangt werden
kann, wenn der Hauptschuldner in Konkurs geraten ist oder der Gläubiger
über einen definitiven Verlustschein verfügt oder der Hauptschuldner
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt hat, kann bei der Solidarbürgschaft
der Bürge bereits dann belangt werden, wenn der Hauptschuldner mit seiner
Leistung in Rückstand und einmal erfolglos gemahnt wurde.
Aus
diesen Schilderungen geht klar hervor, dass eine Solidarbürgschaft
für den Vermieter viel vorteilhafter ist. In formeller Hinsicht ist noch
zu erwähnen, dass eine Solidarbürgschaft nur dann vorliegt, wenn sich
der Bürge unter Beifügung des Wortes «solidarisch» oder
mit anderen gleichbedeutenden Ausdrücken verpflichtet hat. Die Praxis
zeigt, dass eine Bürgschaft im Zusammenhang mit einem Mietverhältnis
selten vorkommt, dies klar im Gegensatz zu
Garantieverträgen. |
|