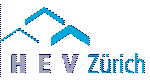
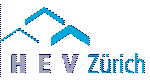 |
||||
| HEV 9/1998 | Inhaltsverzeichnis | ||
| Mietrecht | |||
| Formalismen im
Mietrecht
rz. Bei einseitigen Mitteilungen
wie Kündigungen, Weitergabe von Mietzinssenkungen und
Mietzinserhöhungen lauern Gefahren, vorallem auf der Seite des Vermieters.
Um nicht ein böses Erwachen zu riskieren, sind einige wichtige Punkte zu
beachten, welche nachfolgend aufgelistet sind:
Mietzinserhöhung
Gemäss Art. 269 d Abs. 1 OR
muss eine Mietzinserhöhung auf einem vom Kanton genehmigten Formular
mitgeteilt und begründet werden. Als Beispiel für eine unklare Begründung - die gemäss klarer Gesetzesbestimmung von Art. 269 d Abs. 2 lit. b OR die Mietzinserhöhung nicht nichtig macht, sondern auf dem Wege der Anfechtung für unzulässig erklärt werden könnte - ist die Berufung auf verschiedene, relative und absolute Erhöhungsgründe, ohne deren Verhältnis zueinander bzw. deren Aufschlüsselung näher zu erläutern, zu erwähnen. Nicht von einer Vermischung von zwei Berechnungssystemen ist dann zu sprechen, wenn mit den aufgeführten Kostenständen (Hypothekarzins, Teuerung, Kostensteigerung) einzig dargelegt wird, auf welchen Faktoren die Berechnung des neuen Nettomietzinses und allfällig angebrachte Vorbehalte beruhen. Im Zusammenhang mit der Mitteilung von Mietzinserhöhungen ist weiter zu erwähnen, dass bei Geltendmachung mehrerer Erhöhungsgründe (z.B. Teuerung des risikotragenden Kapitals und wertvermehrende Investitionen) diese jeweils in Einzelbeträgen auszuweisen sind. Aufgrund der Änderung der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG) vom 26. Juni 1996, in Kraft seit 1. August 1996, ist es dem Vermieter erlaubt, da in der Regel der in den vorgedruckten Formularen enthaltene Platz für eine umfassende Begründung kaum ausreicht, eine Mietzinserhöhung in einem Begleitschreiben zu begründen. Mietzinssenkung Gestützt auf Art. 270 a OR kann der Mieter bzw. muss, wenn er seinen Anspruch auf Mietzinsreduktion durchsetzen will, ein schriftliches Herabsetzungsbegehren an den Vermieter oder direkt an die Schlichtungsbehörde unter Einhaltung der Kündigungsfristen und Kündigungstermine stellen. In seinem Begehren muss der Mieter die Gründe für eine Mietzinsreduktion genau nennen, denn es ist ihm ein Nachschieben von anderen Gründen verwehrt. Einem rechnerisch ausgewiesenen Senkungsanspruch kann der Vermieter den Einwand der ungenügenden Nettorendite und bei neueren Bauten (10 - 15-jährig) zusätzlich den Einwand der ungenügenden Bruttorendite erheben. Zudem kann der Vermieter sich auf die orts- und quartiersüblichen Mietzinse berufen. Der Vermieter ist an die in einem Antwortschreiben oder im Rahmen eines Schlichtungsverfahren erhobene Begründung, weshalb er einem Senkungsbegehren nicht entsprechen könne, nicht gebunden. Hat er in seinem Antwortschreiben den Einwand der orts- und quartiersüblichen Mietzinse erhoben, so ist es ihm erlaubt, in einem Schlichtungsverfahren oder vor Mietgericht einer Mietzinssenkung mit der Begründung der ungenügenden Nettorendite entgegenzutreten, sofern tatsächlich keine genügende Eigenkapitalverzinsung vorliegt. Teilt der Vermieter auf dem amtlichen Mietzinserhöhungsformular oder mittels gewöhnlichem Schreiben dem Mieter eine Reduktion des Nettomietzinses infolge gesunkener Hypothekarzinse, unter gleichzeitiger Angabe des neuen, massgebenden Leitzinssatzes mit, so entfaltet diese Mitteilung unter Umständen keine volle Wirkung, selbst wenn der Mieter diese nicht in der 30-tägigen Anfechtungsfrist beanstandet hat. Gemäss einem Entscheid des Bundesgerichtes vom 18. Dezember 1997 kann nämlich der Mieter eine nicht vollständig weitergegebene Mietzinsreduktion auch später noch einfordern. Die vom Vermieter angegebene Berechnungsgrundlage für den neuen Nettomietzins entfaltet keinen Vertrauensschutz. Das Bundesgericht begründet dies damit, dass eine unbestritten gebliebene, zu Ungunsten des Mieters falsch berechnete Mietzinssenkung nicht als bindende Mietzinsfestlegung gelten könne. Die stillschweigende Annahme der Senkung reiche „nicht weiter als die angebotene Senkung“. Bei einer Mitteilung mit dem für Mietzinserhöhungen gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Formular ist nach Auffassung des Schreibenden hingegen eine differenziertere Betrachtung angebracht: Erwähnt der Vermieter die Gründe, die er dem Reduktionsanspruch des Mieters entgegensetzt ausdrücklich, und weist er die einzelnen Parameter im Sinne von Art. 19 Abs. 1 lit. a VMWG betragsmässig aus, so enthält die Formularmitteilung zwei Erklärungen: Zum einen soll die Mietzinssenkung in dem sich aus Art. 13 Abs. 1 VMWG ergebenden Umfang gewährt werden, und zum andern soll der Mietzins nach dem Willen des Vermieters gleichzeitig aufgrund veränderter Kostenfaktoren oder allenfalls auch unter Hinweis auf die orts- oder quartierüblichen Verhältnisse oder unter Hinweis auf andere absolute Gründe wieder erhöht werden. Wird die solcherart korrekt begründete indirekte Mietzinserhöhung in der Folge nicht innert 30 Tagen bei der Schlichtungsbehörde angefochten, so muss ihr die Funktion der letzten massgebenden Mietzinsfestsetzung zukommen, von der aus weitere Mietzinsanpassungen nach relativer Methode möglich sind. Die gleiche Betrachtungsweise gilt für die Verrechnung mit einem bei Vertragsabschluss oder nach einer Handänderung rechtsgültig eingeführten Vorbehalt. Kündigung Obwohl das amtliche Kündigungsformular eine Rubrik „Begründung“ aufweist, ist eine Kündigung erst auf Verlangen des Mieters zu begründen, d.h. eine schriftlich festgehaltene Begründung ist nicht Gültigkeitsvoraussetzung. Begründet der Vermieter seine Kündigung auf dem Formular oder auf Verlangen des Mieters, so ist er an die einmal ausgesprochenen Gründe gebunden. Ein Nachschieben von weiteren Gründen ist unzulässig.Bei einer vom Vermieter zu kurz bemessenen Kündigungsfrist bei einer ordentlichen oder ausserordentlicher Kündigung ist in Anwendung von Art. 266 a Abs. 2 OR die Kündigung auf den nächstmöglichen Kündigungstermin wirksam. Fast als Selbstverständlichkeit versteht sich, dass Art. 266 a Abs. 2 OR bei einem falsch gewählten Kündigungstermin ebenfalls zur Anwendung gelangt. Währenddessen eine ordentliche Kündigung im Nachhinein nicht in eine ausserordentliche umgedeutet werden kann, stellt sich die Frage, ob eine vom Vermieter ausgesprochene ausserordentliche Kündigung (z.B. Sorgfaltspflichtverletzung nach Art. 257 f OR infolge Zulassung einer Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechtes) in eine andere ausserordentliche Kündigung umgedeutet werden kann (z.B. Art. 266 g OR: Kündigung aus wichtigen Gründen). Diese Frage ist dann zu bejahen, wenn der Vermieter nicht nur einen Gesetzesartikel, sondern den dem Mieter vorgeworfenen Sachverhalt in Worten festgehalten hat, denn es ist nicht einsehbar, weshalb eine auf einen falschen Zeitpunkt hin ausgesprochene Kündigung bei Vorliegen eines ausgewiesenen Kündigungsgrundes keine Wirkung entfalten sollte. Art. 266 a OR ist analog anzuwenden. |
||||
| Inhaltsverzeichnis | ||