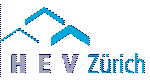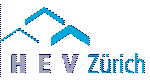|
|
Die Mängelhaftung im
Werkvertrag
dd. Nach Abschluss des
Werkvertrages schuldet der Unternehmer dem Besteller die Herstellung eines
Werkes. Der Maler als Unternehmer verpflichtet sich, dem Hauseigentümer
als Besteller die Hausfassade neu zu streichen. Welche Rechte hat aber nun der
Besteller, wenn kurze Zeit nach dem neuen Anstrich die Farbe abblättert?
Der Besteller muss in diesem Fall beim Unternehmer diesen Mangel rügen und
kann sein Recht auf Wandelung, Minderung oder Nachbesserung des Werkes
ausüben.
Der Werkmangel
Das Gesetz spricht in Art. 368 Abs. 1
OR von „Mängeln“ oder von „Abweichung“ des
Werkes vom Vertrag. Der Werkmangel umfasst sowohl die „Mängel“
als auch die „Abweichung“. Unter einer Abweichung versteht man, dass
das abgelieferte Werk bestimmte vereinbarte oder als selbstverständlich
vorausgesetzte Eigenschaften nicht aufweist. Das Fehlen einer solchen
Eigenschaft bewirkt, dass das Werk mangelhaft ist, und der Vertrag nicht
richtig erfüllt wurde.
Zu den vereinbarten Eigenschaften gehören
die allgemeinen Merkmale wie die Form, Masse, Ausführung oder die Farbe
des Werkes (Bestellung einer Haustüre aus Eichenholz massiv). Es
können aber auch besondere Merkmale vereinbart und bei Vertragsabschluss
vom Unternehmer zugesichert werden (Leistungsfähigkeit einer Maschine).
Der Unternehmer hat sich verpflichtet, dass das Werk diese besondere
Eigenschaft aufweist.
Daneben sind aber auch das Fehlen von Eigenschaften,
die ohne besondere Vereinbarung vorausgesetzt werden, Werkmängel. Darunter
fallen einerseits die Wertqualität und andererseits die
Gebrauchstauglichkeit des Werkes.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
ein Werkmangel dann besteht, wenn entweder eine besonders vereinbarte oder eine
als selbstverständlich vorausgesetzte Eigenschaft fehlt. Die
Unterscheidung zwischen Mangel und Abweichung in Art. 368 OR hat
keine rechtliche, sondern nur eine systematische Bedeutung, auf welche hier
nicht näher eingegangen wird. Für beide Sachverhalte gilt jedoch die
gleiche Regelung.
Die Mängelrechte
Art. 368 OR gewährt dem Besteller drei
verschiedene Mängelrechte: Das Wandelungsrecht, das Minderungsrecht und
das Nachbesserungsrecht. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen erheblichen
und minder erheblichen Mängel (Art. 368 Abs. 1 und 2 OR). Ein
erheblicher Mangel liegt vor, wenn das Werk für den Besteller unbrauchbar
oder zumindest unannehmbar ist. Alle übrigen Mängel sind minder
erheblich, das Werk ist demzufolge brauchbar und annehmbar.
Das Wandelungsrecht
nach Art. 368 Abs. 1 OR setzt einen
erheblichen Mangel voraus. Der Besteller kann die Annahme des Werkes
verweigern, d.h. der Werkvertrag durch einseitige Willenserklärung
auflösen. Diese Auflösung erfolgt mit rückwirkender Kraft, d.h.
es wird der Zustand wieder hergestellt, wie er vor Vertragsabschluss war: Die
gegenseitigen Forderungen der Parteien erlöschen und das bereits
Geleistete muss der Gegenpartei zurückgegeben werden. Die Wandelung des
Werkvertrages bedarf dazu weder ein richterliches Urteil noch eine
übereinstimmende Willenserklärung des Unternehmers. Das
Wandelungsrecht kommt allerdings nur in aussergewöhnlichen Fällen zur
Anwendung.
Das Minderungsrecht
nach Art. 368 Abs. 2 OR setzt einen
minder erheblichen Mangel voraus. Der Besteller kann dabei von der geschuldeten
Vergütung (dem Lohn) eine bestimmte Summe abziehen, welche dem Minderwert
des Werkes entspricht. Zwischen dem mangelhaften Werk (wie es ist) und dem
mängelfrei gedachten Werk (wie es sein sollte) muss eine Differenz im
wirtschaftlichen Wert bestehen. Der Besteller kann die geschuldete
Vergütung durch eine einseitige Willenserklärung herabsetzen. Wie im
Wandelungsrecht setzt diese Herabsetzung weder ein richterliches Urteil noch
eine übereinstimmende Willenserklärung des Unternehmers voraus. Hat
der Besteller mehr geleistet, als er nach der Herabsetzung schuldet, so kann er
diesen Betrag zurückfordern. Dieses Recht entsteht erst durch die
Ausübung des Minderungsrechts.
Das Nachbesserungsrecht
nach Art. 368 Abs. 2 OR setzt einen
minder erheblichen Mangel voraus. Der Besteller kann vom Unternehmer die
unentgeltliche Nachbesserung des Werkes verlangen. Übt der Besteller
dieses Recht aus, so entsteht eine einklagbare Pflicht des Unternehmers zur
Nachbesserung auf seine Kosten. Der Besteller kann diese Pflicht auf dem
zivilprozessrechtlichen Weg durchsetzen. Für das Nachbesserungsrecht wird
weder ein richterliches Urteil noch eine übereinstimmende
Willenserklärung vorausgesetzt. Der Besteller ist nicht verpflichtet, eine
Nachbesserung an Stelle der Wandlung oder Minderung zu verlangen, auch wenn
dies der Unternehmer wünscht. Die Wahl steht einzig dem Besteller zu, der
Unternehmer hat kein Recht auf Nachbesserung.
Für alle drei
Mängelrechte gilt, dass sie unwiderruflich sind. Hat der Besteller z.B.
sein Minderungsrecht ausgeübt, so kann er es nicht zum Erlöschen
bringen, indem er es widerruft. Der Werkvertrag wurde in seinem Inhalt durch
diese Erklärung abgeändert, und kann deshalb nicht mehr
rückgängig gemacht werden.
Neben diesen Mängelrechten
räumt das Gesetz dem Besteller in Art. 368 OR ein
Schadenersatzrecht ein, welches der Besteller sowohl bei erheblichen als auch
minder erheblichen Werkmängeln geltend machen kann. Dieser Anspruch
richtet sich auf den Ersatz des Mangelfolgeschadens unter der Bedingung, dass
sich ein Schaden überhaupt einstellt. Dieses Schadenersatzrecht tritt
zusätzlich zum Wandelungs-, Minderungs- oder Nachbesserungsrecht
hinzu. |
|