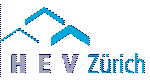
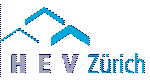 |
||||
| HEV 5/1999 | Inhaltsverzeichnis | ||
| Umwelt | ||
|
|
||||
|
Mobilfunkantennen in der Nachbarschaft
rd. Seit die Telekommunikationsbereiche privatisiert worden sind, stellen vor allem die Firmen DiAx und Orange ihre eigenen Natelantennen auf. Dabei können sich bei den betroffenen Anwohner verschiedene Fragen stellen. Diese Fragen sind einerseits baurechtlicher Natur, andererseits gesundheitlicher Natur. Nachstehend wird versucht, etwas Licht in diese Angelegenheit zu bringen, es muss aber vorweg genommen werden, dass nicht auf jede Frage eine Antwort gefunden werden kann.Das Natel (oder Handy) hat sich innert kurzer Zeit zum eigentlichen Renner entwickelt. Viele Leute möchten nun jederzeit und überall erreichbar sein. Parallel dazu haben die Schweizer nach mehr Privatwirtschaft verlangt. Dies hat nun einerseits die Konsequenz, dass das Natelnetz umfassend ausgebaut wird, andererseits aber auch, dass die neuen Unternehmen DiAx und Orange weitgehend ihr eigenes Netz erstellen. Orange setzt primär auf viele kleine Antennen, welche weniger auffällig sind, DiAx hingegen eher auf wenige grosse Antennen. Wenn nun eine neue Antenne aufgestellt werden soll, so beurteilt sich das Bewilligungsverfahren nach dem kommunalen Baugesetz und natürlich auch nach dem kantonalen Planungs- und Baugesetz. Auf kommunaler Stufe kann geregelt sein, dass für gewisse Bauvorhaben ein erleichtertes Bewilligungsverfahren vorgesehen ist. Ob ein konkretes Bauvorhaben regulär ausgeschrieben werden muss oder im erleichterten Verfahren bewilligt werden kann, muss die Baubehörde entscheiden, soweit das Gesetz selber darüber keine Antwort enthält. Die Stadt Zürich hat bisher gewisse Mobilfunkanlagen im erleichterten Verfahren bewilligt, hat diese Praxis aber nun geändert (NZZ vom 12. März 1999, S. 47) und schreibt alle diesbezüglichen Baugesuche öffentlich aus. Gegen diese Baugesuche kann man Einsprache erheben. Ob man aber mit einer solchen Einsprache auch durchdringt und den Bau einer solchen Anlage verhindern kann, muss in jedem einzelnen Fall neu beurteilt werden. Jedenfalls hat das Zürcher Verwaltungsgericht bereits 1998 entschieden, dass kleinere Infrastrukturanlagen, worunter auch eine 15 Meter hohe Mobilfunkantenne gehört, in einer Wohnzone grundsätzlich zulässig sind. Die Gemeinden können wohl gemäss dem kantonalen Planungs- und Baugesetz gewisse gewerbliche Nutzungen in der Wohnzone zulassen. Neben dem umfassenden Immissionsschutz in der Wohnzone kann also auch über eine funktionale Betrachtungsweise die Zonenkonformität bejaht werden, was also heisst, dass der Immissionsschutz in der Wohnzone nicht das alleinige Argument zu sein braucht. Das Gericht hat aber festgehalten, dass die funktionale Betrachtungsweise nur dort eine Rolle spielt, wo es sich bei der geplanten Nutzung um einen Betrieb oder ein Gewerbe im baurechtlichen Sinne handelt. Dies ist gemäss Verwaltungsgericht aber bei einer Mobilfunkantenne gerade nicht der Fall. Es kommt daher zum Schluss, dass das Aufstellen einer Mobilfunkanlage in der Wohnzone grundsätzlich zulässig ist. Stehen allerdings verschiedene mögliche Standorte zur Auswahl, so muss sicherlich jener Standort gewählt werden, an welchem die Immissionen am geringsten sind. Ein anderes Argument gegen die Mobilfunkanlagen sind die befürchteten gesundheitlichen Störungen wegen des sogenannten Elektrosmogs. Diese Immission ist vor allem bekannt geworden im Zusammenhang mit Hochspannungsleitungen oder starken Radiosendern (z.B. der Fall Schwarzenburg). Zu solchen gesundheitlichen Auswirkungen und zum Stand der Wissenschaft auf diesem Gebiet hat das Bundesgericht ausführlich in BGE 124 II 219 Stellung genommen. Bisher haben sich die Betreiberfirmen zudem freiwillig an die Richtlinien des BUWAL gehalten (sogenannte IRPA-Richtlinien). Diese Richtlinien werden wohl nicht mehr lange Gültigkeit haben, da eine Verordnung in der Vernehmlassung ist, welche die Grenzwerte nun auf Gesetzesstufe festlegen soll. Die Verordnung und der erläuternde Bericht dazu sind im Internet –abrufbar unter der Adresse: www.buwal.ch/presse/1999/d9902161.htm (unter Ziffer 1 und 2 am unteren Seitenende). Anlagen, die dem künftigen Standart nicht genügen, müssen dann angepasst oder versetzt werden. Ob aber die Strahlung, welche von Mobilfunkantennen ausgeht, für die Gesundheit schädlich sein kann, ist damit konkret noch nicht geklärt. Zu bedenken bleibt, dass die ausgehende Leistung solcher Anlagen sehr viel schwächer ist, als jene von internationalen Radiosendern oder gar Hochspannungsleitungen. Zudem ist es so, dass die Strahlung mit zunehmender Distanz sehr stark abnimmt. Ferner ist zu bedenken, dass der Konsument nun einfach ein solches Natelnetz fordert, worauf auch die Rechtsprechung im gebotenen Masse Rücksicht nimmt. Leidet man unter Schlafstörungen oder ähnlichen Beschwerden, so kann es sein, dass der Radiowecker oder der Fernseher – auf «stand by» geschaltet – unter Umständen stärkere Strahlung abgibt, als eine Natelantenne vor dem Haus. Auch ist oft nicht zu unterscheiden, ob Beschwerden bloss wegen der Furcht vor Immissionen verspürt werden oder diese tatsächlich auf die Immissionen zurückzuführen sind. Jedenfalls haben auch schon Anwohner, nachdem kürzlich eine solche Antenne im Wohngebiet aufgestellt wurde, beim Antennenbetreiber kollektiv über massive Beschwerden geklagt, wonach man den geplagten Anwohnern nachweisen konnte, dass die Antenne bisher noch gar nicht in Betrieb genommen wurde. Elektrosmog
Stellungnahme des
Bundesrates Der Bundesrat will nicht nur die schädlichen Wirkungen von sogenannten nichtionisierenden Strahlungen verhindern, sondern auch deren Langzeitbelastung niedrig halten. Vorgesehen ist ein Maximalwert, welcher 90% unter demjenigen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt. Eine entsprechende Verordnung wird vorbereitet. Ein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung erscheint selbst an den für Personen zugänglichen Orten als nicht gegeben. Die vermehrte Installation von Natel-Antennen in Wohngebieten hat in den Medien zu einer recht heftigen Diskussion über die Gefährlichkeit der Strahlung für die menschliche Gesundheit geführt. In diesem Zusammenhang richtete Nationalrat Rolf Hegetschweiler im Dezember vergangenen Jahres an den Bundesrat folgende Interpellation (Wortlaut leicht gekürzt) Im Hinblick auf die in nächster Zeit geplante Installation von rund 2500 neuen Natel Sende- und Empfangsantennen in der Schweiz bitte ich den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:
In nächster Zeit werden rund 2500 neue Natel Sende- und Empfangsantennen in der ganzen Schweiz installiert. Dabei stellen sich insbesondere zwei Probleme:
Um dies zu erreichen, ist die Bildung einer Schweizerischen Koordinationsstelle für Antennenstandorte unter Beizug von Fachleuten zu prüfen. Eine solche Koordinationsstelle müsste folgende Ziele verfolgen:
(Leicht gekürzt) Per 1. Januar 1998 ist das revidierte Fernmeldegesetz in Kraft getreten, welches eine Liberalisierung des Fernmeldewesens und die Einführung eines Konzessionsregimes betreffend die Fernmeldedienste und - netze vorsieht. Das Gesetz will laut Botschaft bewusst den entsprechenden Wettbewerb bei den Fernmeldediensten einschliesslich deren Netze fördern. Bezüglich der angesprochenen Mobilfunk- netze hat die verwaltungsunabhängige Eidgenössische Kommunikationskommission im Frühjahr 1998 zwei neue landesweite Konzessionen mit längerfristigen Erschliessungsvorgaben von ca. 95 % der Wohnbevölkerung vergeben, so dass zur Zeit insgesamt drei unabhängige Mobilfunknetze (Swisscom, Diax, Orange) konzessioniert sind. Bau- und planungsrechtliche Fragen wurden nicht im Rahmen der Konzessionierung behandelt, sondern sind in den jeweiligen Baubewilligungsverfahren zu beantworten. ... Falls bei der Erfüllung einer Bundesaufgabe ein Objekt des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN) betroffen wird, ist seitens der Kantone in Anwendung des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) ein Gutachten der Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) einzuholen. Die Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach Art. 24 RPG ist eine delegierte Bundesaufgabe: Bei solchen Bewilligungen hat die zuständige Behörde dafür zu sorgen, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler geschont werden und, wo das allgemeine Interesse an ihnen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben. ... Zur ersten Frage: Die Koordination der Baubewilligungen erfolgt durch die zuständigen kantonalen Behörden. Zusätzlich legte das BAKOM den Konzessionärinnen nahe, ihre Netze selbständig möglichst weitgehend untereinander zu koordinieren, da sie damit das Risiko von Verzögerungen, verweigerten Bewilligungen und Rechtsmittelverfahren für Anlagen ausserhalb der Bauzonen erheblich senken können. Die Mobilfunkbetreiberinnen legen deshalb den Kantonen in der Regel die jeweils gültige Planung der Antennenstandorte direkt vor, damit die Kantone eine Gesamtsicht über die Antennenstandorte auf ihrem Gebiet erhalten und die Bewilligungen koordinieren können. ... Die Installation der Mobilfunkantennen verläuft somit nicht unkoordiniert. Zur zweiten Frage: ... Die Optimierung auf möglichst wenig Standorte erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Koordinierung der Baubewilligungen durch die Kantone. Diese können, falls sich die Mobilfunkbetreiber nicht freiwillig einigen, beim BAKOM Antrag auf Verfügung von gemeinsam zu nutzenden Antennen stellen. Zur dritten Frage: Gemäss Abklärungen des BAKOM werden die 1988 von der IRPA (International Radiation Protection Association) empfohlenen und 1998 durch die WHO/ICNIRP (International Commission for None-Ionizing Radiation Protection) bestätigten Immissionsgrenzwerte an den für Personen zugänglichen Standorten im Allgemeinen wesentlich unterschritten. Ein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung ist somit gemäss WHO nicht anzunehmen. Die Belastung der Umwelt durch nichtionisierende Strahlung wird mit den neuen Mobilfunknetzen allerdings zunehmen. Der Bundesrat hat bereits ... festgehalten, dass er die Langzeitbelastung im Sinne der Vorsorge niedrig halten will. Damit will er nicht nur gesicherte schädliche Wirkungen verhindern, sondern auch die Risiken für mögliche Langzeitschäden vermindern. In diesem Zusammenhang bereitet der Bundesrat eine Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vor (NISV). Der vom UVEK kürzlich in die Vernehmlassung gegebene Entwurf NISV schlägt einen Freihaltebereich für die Vorsorge vor. Ausserhalb dieses Freihaltebereiches werden 10 Prozent des WHO-Immissionsgrenzwertes nicht überschritten. Vorgesehen ist also ein Maximalwert, der 90% unter demjenigen der WHO liegt. Dieser Freihaltebereich soll eingehalten werden, wenn dies mit verhältnismässigen Massnahmen beim Bau der Antennen möglich ist. Zur vierten Frage: Zur Zeit drängt sich aufgrund der erwähnten Massnahmen (Antworten 1 - 3) keine weitere Intervention des Bundesrates auf. |
||||
| Inhaltsverzeichnis | ||