|
|
|
 |
 |
 |
 |
Pflanzenjagd
– abenteuerlich und gefährlich
* Barbara Scalabrin-Laube Wer
im Winter durch den Garten geht und sich an den gelben Blüten des Jasmins
(Jasminum nudiflorum) freut, wird kaum daran denken, dass er dieses Gehölz
dem schottischen Pflanzenjäger Robert Fortune (1812-1880) verdankt,
welcher 1844 Jasminsamen aus Westchina nach Europa brachte. Damals war er im
Auftrag der englischen Horticultural Society nach China gereist, um die
chinesische Gartenkunst zu studieren und Samen von neuen, winterharten Pflanzen
zu sammeln. Vor allem sollte er nach blauen Pfingstrosen, gelben Kamelien (!),
Lilien, Orangenbäumen und verschiedenen Teesorten suchen. Obwohl er unter
extremen Temperaturen und Entbehrung litt, ihm die Einheimischen mit Misstrauen
begegneten und ihn gar bedrohten, gelang es ihm, seine Aufgabe zu
erfüllen. Viele weitere Pflanzen wie z.B. die Weigelie (Weigelia florida)
aus Nordchina, die Forsythie (Forsythia viridissima) oder der Rhododendron
(Rhododendron fortunei) aus Südostchina fanden dank der
Hartnäckigkeit dieses ehrgeizigen Forschers den Weg in unsere Gärten.
Später sollte er zudem Japan erforschen, von wo er etwa die Herbstanemone
(Anemone hupehensis var. japonica) und die Mahonie (Mahonia japonica)
mitbrachte. |
 |
| |
|
|
Obwohl die europäische Flora reich und
vielfältig ist, fühlten sich Gärtner und Pflanzenfreundinnen
schon immer vom Fremden und Exotischen angezogen. So wachsen heute in unseren
Gärten Penstemon und Lupinen aus Nordamerika neben Gladiolen und Geranien
aus Südafrika. Eine achttausend Kilometer lange Reise haben die
Rhododendren aus dem Himalaja hinter sich, während die einheimische
Heckenrose schon längst von den edleren Schwestern aus China
verdrängt wurde. Die Liste der Fremdlinge könnte unendlich
verlängert werden, obwohl nur ein kleiner Teil aller gesammelten Pflanzen
kultiviert und als gartenwürdig befunden worden ist. |
|
 |
| |
| |
Einige
Pflanzenjäger wie z.B. Sir Joseph Dalton Hooker (1817-1911), ein Freund
von Darwin und Leiter des botanischen Gartens Kew, nahmen die meist
entbehrungsreichen und gefährlichen Reisen aus wissenschaftlicher Neugier
auf sich. Ihnen ging es darum, die nationalen botanischen Datenbanken zu
vervollständigen und die Klassifizierung der Flora voranzutreiben. Andere
hingegen waren mehr an Neuheiten für den Garten interessiert, wie die
folgenden Beispiele zeigen: |
|
| |
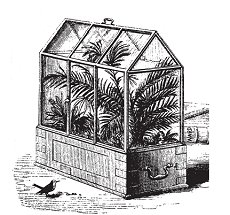
Eine Erfindung von Nathaniel Ward:
Verglaste «Pflanzenkäfige» für den Transport
|
|
Die klassische
Schönheit und den einmaligen Duft der Königslilie (Lilium regale)
verdanken wir Ernst Wilson (1876-1930). Im August 1910 entdeckte er die
zauberhaften Blüten in einem unwegsamen Tal in Sichuan, wo es im Sommer
sehr heiss und im Winter äusserst kalt ist. 6000 Zwiebeln gruben die
Träger nach der Blüte aus, bevor sie sich zusammen mit ihrem
müden, aber glücklichen Führer auf den Rückweg nach Yichang
machten. Unterwegs fiel Wilson aus Unachtsamkeit aus der Sänfte,
stürzte in eine Felsspalte und brach sich mehrmals das Bein. Während
er auf dem Trampelpfad lag und sein Bein mit dem Fotostativ schiente, nahte ein
Herde Maultiere, welche über den Verunfallten stolperte, ihn jedoch nicht
verletzte. Drei Tage später erreichte die Gruppe ein Missionslager, wo das
Bein trotz massiver Infektion gerettet werden konnte. |
|
| |
Kaum
war der Forscher genesen (er sollte sein Leben lang behindert bleiben), liess
er 5000 gepresste Pflanzen und 1285 Samenpakete an seinen Auftraggeber
schicken. Darunter befanden sich - wie sich bei der späteren Sichtung
herausstellte - 323 neue Arten. Insgesamt verdanken wir diesem
Pflanzenjäger über tausend "Neuheiten". In unserem Garten findet man
z.B. folgende «Wilsons»: den mit seinen weissen
Scheinblütenblättern auffallenden Taschentuchbaum (Davidia
involucrata), den Schatten verträglichen immergrünen Schneeball
(Viburnum davidii), den Blütenhartriegel (Cornus kousa var. chinensis),
die einmal blühende Strauchrose (Rosa moyesii), die gelbe Clematis
(Clematis tangutica) und die rosarote Clematis montana var. rubens wie auch das
nicht ganz winterharte Bleikraut (Ceratostigma willmotianum).
Vielleicht wachsen in Ihrem Garten Lupinen (Lupinus
polyphyllus) und Zierjohannisbeeren (Ribes sanguineum). Beide Pflanzen wurden
von David Douglas (1799-1834) in Kalifornien entdeckt. Schon als
Elfjähriger begann der Schotte eine sieben Jahre dauernde
Gärtnerlehre, während der er wegen seines Interesses an der Botanik
auffiel und entsprechend gefördert wurde. 1823 reiste er im Auftrag der
neu gegründeten Pfanzengesellschaft Horticultural Society nach
Nordamerika, von wo er ein Jahr später mit vielen neuen Sorten von Apfel-,
Birn-, Pfirsich- und Zwetschgenbäumen und Trauben sowie unbekannten
Zierpflanzen nach England zurückkehrte. Weitere Exkursionen nach Amerika
folgten. Diese wurden jeweils von den Mitgliedern der Horticultural Society
finanziert, welche je nach Höhe ihrer Subskription eine Anzahl exotischer
Samen bekamen. |
|
| |
Wer in
jener Zeit in der neureichen, englischen Gesellschaft Rang und Namen haben
wollte, musste seinen Erfolg unter anderem mit dem Kauf eines Landhauses mit
passendem Garten beweisen. David Douglas' wohl berühmtester Fund war -
neben vielen weiteren Koniferen - die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) aus den
kanadischen Bergen. Da er über seine Exkursionen Tagebuch führte, ist
bekannt, welche Abenteuer und Gefahren er zu bestehen hatte. Von seiner letzten
Exkursion auf Hawaii kehrte er nicht mehr zurück, denn nach einer Nacht
bei einem Trapper fiel er in eine Falle und wurde vom darin gefangenen Bullen
zu Tode getrampelt. Gerüchten zufolge soll ihn der Trapper
eigenhändig in die Falle gestossen haben, weil der Forscher ein
Verhältnis mit dessen Frau gehabt hatte. Das Geheimnis wurde nie
gelüftet. |
|
|
|

Illustration von Miss Drake:
Pflanzen, welche David Douglas aus
Nordwestamerika nach Europa brachte. |
| |
| |
Natürlich
reisten nicht nur Briten in ferne Länder, um Pflanzen zu suchen, sondern
auch deutsche, französische und holländische Forscher waren
unterwegs, um «grünes Gold» zu finden. So reiste der Mediziner
Philipp Franz von Siebold (1796-1866) 1823 nach Nagasaki, wo er sich auf der
Vorinsel Dejima einrichtete. Ausländern war das Betreten Japans damals
nicht erlaubt, doch dank Beziehungen zu japanischen Ärzten gelang es ihm,
Pflanzen zu bekommen und ins Landesinnere zu reisen. Sechs Jahre nach seiner
Ankunft wurde er wegen Verdachts auf Spionage des Landes verwiesen und nach
Holland zurück geschickt. 120 Kisten mit gesammelten Schätzen waren
in seinem Gepäck; 250 der 500 gesammelten Pflanzen überlebten den
Transport, darunter die Sternmagnolie (Magnolia stellata), die Glyzinie
(Wisteria floribunda) und der Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa). Kurz vor
seinem Tod konnte der Sammler mit seinem deutschen Sohn zusammen nach Japan
zurück kehren und seine japanische Frau und die gemeinsame Tochter
besuchen. Offenbar hatten die niederländischen Diplomaten in Japan den
Eindruck, dass Siebold sich zu sehr in ihre Geschäfte einmischte, was
möglicherweise stimmte. In der Folge wurde er nach Europa zurück
berufen, wo er kurz darauf starb.
Die
«Jagdgeschichten» sind nicht abgeschlossen, denn noch immer werden
Exkursionen gesponsert. Vor etwa zehn Jahren brachte der Engländer Roy
Lancaster beispielsweise den blauen Lerchensporn (Corydalis flexuosa) aus China
in unsere Gärtnereien. Sheila und Spencer Hannay fanden gleichzeitig die
rotblättrige Wolfsmilch Euphorbia «Chamäleon» in der
Dordogne, während Elizabeth Strangman auf einer Exkursion im ehemaligen
Jugoslawien auf den Storchenschnabel Geranium phaeum «Samobor»
stiess. Von Bleddyn und Sue Wynn Jones weiss ich, dass sie ihre Crûg Farm
Nursery in Nordwales jeweils im Oktober für drei Monate schliessen, um auf
Pflanzenjagd nach Asien zu fliegen. Falls Sie sich für ihre Expeditionen
interessieren, erfahren Sie mehr unter
www.crug-farm.co.uk.
Alle diese Sammlerinnen und Sammler bringen vorzugsweise Samen und Stecklinge
zurück, um die Flora zu schonen.
Neugierig verfolge ich jeweils die Berichte über
Pflanzenexpeditionen. Dabei suche ich nicht nur nach unbekannten Kostbarkeiten
für den Garten, sondern freue mich, dass trotz des grossen Wissens
über die Flora weiterhin erfolgreich geforscht werden kann. Ausserdem
gleichen die Expeditionsberichte der einzelnen Forscher und Forscherinnen oft
Abenteuerromanen. Vielleicht haben Sie Lust, die Porträts der deutschen
Pflanzenjäger im neu erschienen Buch «Pflanzenjäger»
(Piper, München 2002) von Kej Hielscher und Renate Hücking zu
lesen.
* Cottage
Garden, 8453 Alten |
|
| |
|
|
|

