|
|
|
| |
|
|
| |
Die Pflegeplanung
*
Luzius Winkler |
|
| |
|
|
| |
Wozu den Artikel
von Herrn Winkler lesen, wenn ich doch weiss, wie mein Garten aussieht und was
zu machen ist?, denkt manch ein Einfamilienhausbesitzer. Die Pflegeplanung
sieht aber mehr vor als nur eine Planung der momentanen Situation.
Ursprünglich entstanden ist die Pflegeplanung bei grossen Parks im
Zusammenhang mit der Denkmalpflege, denn oft wurden historische Zeitzeugen
abgerissen, weil das Bewusstsein fehlte, dass es sich um Zeitzeugen handelte.
Oft wurde nach dem Gusto des verantwortlichen Verwalters das eine oder andere
Steckenpferd in der Grünanlage über alles gefördert,
während andere Bereiche vernachlässigt wurden. Gelegentlich konnte
man sogar den Wechsel der Unterhaltsequipe feststellen. Derartige
Missstände können mit einem Pflegekonzept vermieden werden. Im
Bereich des Einfamilienhauses hilft ein Pflegeplan insofern, als er die
Entwicklung des Gartens im Laufe von 10 bis 20 Jahren darstellen
sollte. |
|
| |
|
|
|
|
| |
 |
|
Auch ein Bauerngarten braucht Pflege. |
|
| |
|
|
| |
Die
Pflegeplanung enthält vier Teile.
1. Entwicklungsgeschichte
Der
erste Teil einer Pflegeplanung befasst sich mit der Geschichte des Gartens. Es
geht in diesem Teil um folgende Fragen: Wann wurde der Garten angelegt? Wer
waren die Besitzer? Wer und wann und durch wen wurden Neuerungen im Garten
getätigt? Weiter führende Fragen sind, welche politischen
Einflüsse bestimmten den Park?, welche Stilrichtungen waren am Parkkonzept
massgeblich beteiligt? Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, gibt es
heute in Italien nur noch sehr wenige historische Renaissancegärten, da
die meisten während und nach der Zeit des Sonnenkönigs in
französische Gärten überführt wurden und später unter
dem Einfluss des englischen Landschaftsparks nochmals stark umgebaut
wurden.
Dieser Teil kann für den
Einfamilienhausbesitzer relativ kurz abgehandelt werden. Oft sind solche Fragen
jedoch spannend, da man gewisse Teile des Gartens, welche vorher
unerklärbar waren und immer gestört haben, plötzlich
versteht. |
|
| |
|
|
| |
2.
Bestandesaufnahme und Zustandsbeschreibung |
|
| |
Zuerst wird der Garten mit sämtlichen Teilen,
sowohl Pflanzen als auch baulichen Elementen, im Grundriss aufgenommen. Der
Pflanzenbestand spielt eine ganz zentrale Rolle. Es ist abzuschätzen, wie
detailliert die Anlage aufgenommen werden soll, insbesondere bei der
Bepflanzung. Wenn die Aufnahme zu grob ist, fallen viele Details durch die
Maschen. Aber genau diese Details können vielleicht den Charme ihres
Gartens ausmachen.
Bei der
Zustandsbeschreibung geht es darum, die einzelnen Teile des Gartens in einem
Plan festzuhalten und einer Zeit zu zuordnen. Bei der Zustandsbeschreibung darf
keine Bewertung der einzelnen Objekte erfolgen, es soll sich um eine reine
Beschreibung handeln. |
|
|
|

Die
Visitenkarte des Hauses:
der perfekt
gepflegte Vorgarten. |
| |
| |
|
|
| |
3.
Bewertung
Jetzt werden die einzelnen
Elemente bewertet. Es können ganz verschiedene Aspekte bewertet werden.
Bei denkmalpflegerischen Konzepten ist es der kulturhistorische und
ökologische Wert, wo oft noch eine Schadenskartierung dazu kommt. Im
Privatgarten sind es oftmals andere Aussagen, welche interessant sind. Wie zum
Beispiel der persönliche Wert, wie arbeitsintensiv jeder Bereich ist, oder
ganz einfach wie kostenintensiv die einzelnen Teile sind. Die Bereiche auf ihre
zu erwartende Lebensdauer zu kartieren, kann von grossem Interesse sein, wenn
es darum geht, künftige Kosten abzuschätzen. |
|
| |
|
|
| |
4. Pflege und Entwicklungsplanung
Nachdem man die relativ zeitintensive Vorarbeit gemacht
hat, wird es spannend. Denn nun kann man mit dem Spiel beginnen. Das
Pflegekonzept sollte drei Zeitstufen aufzeigen mit folgenden Zeithorizonten:
unterste (erste) Stufe 1 Jahr, mittlere (zweite) Stufe 3 bis 5 Jahre und
oberste (dritte) Stufe 10 bis 20 Jahre. Es ist darauf zu achten, dass die
einzelnen Pflegemassnahmen auf jeder Stufe Sinn machen, ansonsten ist die
Pflege kontraproduktiv.
So steht auf der
obersten Stufe die Vision. Folgende Fragestellungen helfen, die Vision zu
definieren: Was ist mir wichtig? Sollte der Garten pflegeleicht sein? Die
Vision sollte budgetunabhängig entstehen, daher ist es auch eine
Vision. |
|
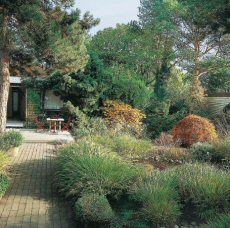
Im Herbst
wird der richtig gepflegte Garten zu einer Freilichtbühne. |
|
| |
| |
In der
nächsten Stufe werden mittelfristige Ziele aufgezeigt. Meistens handelt
sich um Arbeiten, welche extern vergeben werden müssen und kostspielig
sein können. So zum Beispiel Sanierungsarbeiten von Mauern, Wegen und
Treppen oder der Schnitt von grossen Solitärbäumen.
Die unterste Stufe ist das konkrete Pflegekonzept
für das kommende Jahr. Auf dieser Stufe ist es wichtig, dass es
möglichst konkret ist. Wenn in der Vision steht, dass der Rasen in eine
Naturwiese überführt werden sollte, so darf auf der untersten Stufe
der Rasen nicht mehr gedüngt werden und die Schnittintervalle sind auf
zwei bis drei Schnitte pro Jahr zu reduzieren. Auf dieser Stufe steht, wann,
wie oft und wie hoch eine Hecke geschnitten werden sollte. Wenn es um
Neupflanzungen geht, ist auch ein konkreter Pflanzplan
beizulegen.
Das konkrete Pflegekonzept
hilft auch, um Arbeiten extern zu vergeben, und die Kosten können auf
diese Art und Weise besser verglichen werden. Denn nun weiss jeder
Gärtner, was Ihre Wünsche sind, was Ihnen wichtig ist und welcher
Teil des Gartens eher verwildern darf. Die meisten Pflegekonzepte scheitern, da
eine der drei Stufen nicht exakt genug umschrieben ist.
Ich hoffe, Ihnen die Vorteile eines Pflegekonzeptes
aufgezeigt zu haben, und wünsche, dass Sie sich die Zeit während des
Winters nehmen, um Ihre Vision zu definieren, damit Sie im Frühjahr
zielbewusst starten können. |
|
| |
|
|
| |
*
Landschaftsarchitekt HTL |
|
| |
|
|
|

