|
|
|
| |
|
|
| |
Pendeln als Lebensform
Medienmitteilung des Statistischen Amtes / statistik.info 02/2005 |
|
| |
|
|
| |
Seit 1970 hat sich der Berufspendelverkehr im Wirtschaftsraum
Zürich stark gewandelt. Das Verkehrsvolumen hat zugenommen, und
die Pendelströme sind vielfältiger geworden. Das werktägliche
Hin und Her zwischen Wohn- und Arbeitsort prägt mittlerweile den
Alltag. Es verleiht der Grossregion Zürich gewissermassen einen
Puls und steht in direkter Wechselwirkung mit der Siedlungsstruktur
des Wirtschaftsraums. Dies zeigt eine soeben veröffentlichte
Studie des Statistischen Amtes. |
|
| |
|
|
| |
Zwischen 1970 und 2000 hat der Berufspendelverkehr
im Wirtschaftsraum Zürich
stark zugenommen. Zum einen ist die Zahl
der Pendlerinnen und Pendler massiv gestiegen,
zum anderen sind auch die Arbeitswege
deutlich länger geworden: 1970
betrug die durchschnittliche Luftliniendistanz
zwischen Wohn- und Arbeitsort 4,1
Kilometer, im Jahr 2000 dagegen 10,8 Kilometer.
Der Anteil der Erwerbstätigen mit
einem Arbeitsweg von mehr als zehn Kilometern
ist denn auch von 12 auf 35 Prozent
gestiegen. Kaum verändert haben sich
jedoch die mittleren Wegzeiten. 1970 wendeten
Erwerbstätige durchschnittlich 26
Minuten auf, um die Entfernung zwischen
Wohn- und Arbeitsort zu überwinden,
2000 dauerte der typische Arbeitsweg mit
28 Minuten nur geringfügig länger. Dies
zeigt eine Analyse der letzten vier eidgenössischen
Volkszählungen, die das Statistische
Amt des Kantons Zürich vorgenommen und
kürzlich veröffentlicht hat. |
|
| |
|
|
| |
Pendelströme immer komplexer
Die Pendelströme sind nicht nur angeschwollen,
sondern auch vielfältiger geworden.
Seit 1970 hat sich die Zahl der von
einem bestimmten Wohnort aus angependelten
Gemeinden im Schnitt etwa verdreifacht.
Früher dominierte ein Muster sternförmig
verlaufender Pendelbeziehungen
zwischen den Zentren – besonders der
Stadt Zürich – und ihrem Umland. Dieses
einfache Muster ist in den letzten Jahrzehnten
durch ein komplexes räumliches
Geflecht sich kreuzender Pendelströme
abgelöst worden. So ist es heute zum Beispiel
nicht ungewöhnlich, im Knonaueramt
zu wohnen und am Zentrum Zürich vorbei
ins Glattal zur Arbeit zu fahren – früher kam
dies nur in Ausnahmefällen vor. In der
Fachsprache: Während noch 1970 radiale
Bewegungen den Grossteil des Pendelverkehrs
ausmachten, tragen heute, neben
dem nach wie vor wachsenden Radialverkehr,
tangentiale Pendelbeziehungen massgeblich
zum Verkehrsaufkommen bei. Die
zunehmende Komplexität der Pendelbeziehungen
steht in enger Wechselwirkung mit
der Verkehrsmittelwahl. Sie wird erst möglich
durch die universale Verfügbarkeit des
Autos, macht es auf der anderen Seite aber
auch unentbehrlich, denn der netzgebundene öffentliche Verkehr ist nur auf den
zentrumsbezogenen Radialstrecken konkurrenzfähig. |
|
| |
|
|
| |
Neue Arbeitsplatzzonen
Ursache – und zugleich Folge – dieser
Entwicklung ist die heutige raumgreifende
Siedlungsstruktur im «Stadtland Schweiz»,
die für Erwerbstätige meist eine Trennung
von Wohn- und Arbeitsort mit sich bringt.
Hinzu kommt in neuerer Zeit eine allmähliche
Dekonzentration der Arbeitsplätze im
Zürcher Wirtschaftsraum. Agglomerationszentren,
speziell Zürich, Winterthur und
Schaffhausen, verlieren als Arbeitsorte an
Bedeutung, während unmittelbar benachbarte
Gemeinden zulegen: Die stark verdichteten
urbanen Arbeitsplatzzonen wachsen
über die Stadtgrenzen hinaus. Die
Gemeinden der Glattalstadt (Kloten, Opfikon,
Wallisellen, Dietlikon, Dübendorf) und
der Limmattalstadt (Schlieren, Urdorf, Dietikon,
Spreitenbach) gehören heute zusammen
mit der Stadt Zürich zum Kerngebiet
des Wirtschaftsraums, das nicht weniger als
12 Prozent der in der Schweiz wohnhaften
Erwerbstätigen beschäftigt. Laut der Analyse
des Statistischen Amts wies diese Region im Jahr 2000 einen positiven Pendlersaldo
von 192 000 Personen auf, das heisst, die
Zahl der Zupendler überstieg diejenige der
Wegpendler um diesen Betrag. Positive
Pendlersaldi sind typisch für Gebiete mit
hoher Arbeitsplatzkonzentration – in reinen
Wohngegenden dagegen sind die Pendlersaldi
negativ. |
|
| |
|
|
| |
Traditionelle Zentren verlieren
an Bedeutung
Gemessen an der Entwicklung des Pendlersaldos
weist der Zürcher Wirtschaftsraum
auch in der Agglomeration Zug (Zug, Baar,
Cham, Hünenberg, Risch) und am oberen
Zürichsee (Rapperswil, Freienbach, Lachen)
dynamische Arbeitsplatzzonen auf, die in
Zukunft noch weiter zulegen dürften. In
traditionellen Industriezentren wie Winterthur,
Schaffhausen, Wetzikon, Rüti, Horgen
oder Baden ist dagegen eine gegenläufige
Entwicklung zu beobachten: Obwohl
die Pendlersaldi nach wie vor positiv sind,
verlieren sie als Arbeitsorte an Bedeutung.
Die so genannte Suburbanisierung der
Arbeitsplätze – also deren Verlagerung aus
den Zentren in den stadtnahen Raum – spiegelt den Strukturwandel der Wirtschaft
in den vergangenen Jahrzehnten wider.
Dieser Strukturwandel umfasst das starke
Wachstum des Dienstleistungssektors
zulasten der traditionellen Industriezweige,
aber auch den Aufschwung neuer Hightech-
Industrien, die etwa in der Agglomeration
Zug eine wichtige Rolle spielen. |
|
| |
|
|
| |
Pendeln ist selbstverständlich geworden
Der Dekonzentration der Arbeitsplätze
ging bekanntlich eine solche des Wohnens
voraus. Auch wenn das Wohnen in der
Stadt zurzeit eine Renaissance zu erleben
scheint, verloren zwischen 1970 und 2000
die Zentren – sowie sehr periphere Regionen
– als Wohnorte massiv an Bedeutung,
während das Umland der Kernstädte zum
bevorzugten Wohngebiet wurde. Als Folge
dieser sich überlagernden Dekonzentrationsbewegungen
entfernen sich Arbeitsund
Wohnort der Erwerbstätigen immer
weiter voneinander, und das Pendeln über
grössere Distanzen ist in den vergangenen
30 Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden.
Gemäss Statistischem Amt sind die
Pendelströme eines der wichtigsten Definitionsmerkmale
eines modernen Ballungsraums.
Sie prägen das Verkehrsaufkommen
in den Stosszeiten, damit die Verkehrsinfrastruktur
– und damit auch den ganzen
Raum. |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Wirtschaftsraum Zürich
Quelle: Bundesamt für Statistik, Volkszählung 2000
Der Wirtschaftsraum Zürich ist das grösste und wirtschaftlich bedeutendste Ballungsgebiet
der Schweiz. Ausgangspunkt für dessen Abgrenzung ist die so genannte Metropolitanregion
Zürich, die neben der Kernagglomeration Zürich elf weitere Agglomerationen in sieben
Kantonen umfasst. Hier wohnen 23 Prozent der schweizerischen Bevölkerung, und hier
arbeiten 27 Prozent der
Erwerbstätigen des Landes.
Diese erwirtschaften zusammen
rund ein Drittel des
schweizerischen Volkseinkommens.
Die einzelnen
Agglomerationen der Metropolitanregion
sind durch
den Austausch von Gütern
und Dienstleistungen sowie
den Berufspendelverkehr
eng mit ihrem Umland verflochten.
Resultat ist ein
funktional und räumlich
zusammenhängendes Gebiet,
das vom Zugersee bis
nach Süddeutschland und
von Aarau bis nach Wil (SG)
reicht: der Zürcher Wirtschaftsraum. |
|
| |
|
|
| |
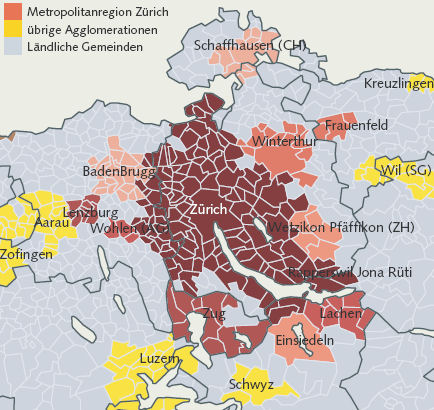
Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich |
|
| |
|
|
|

